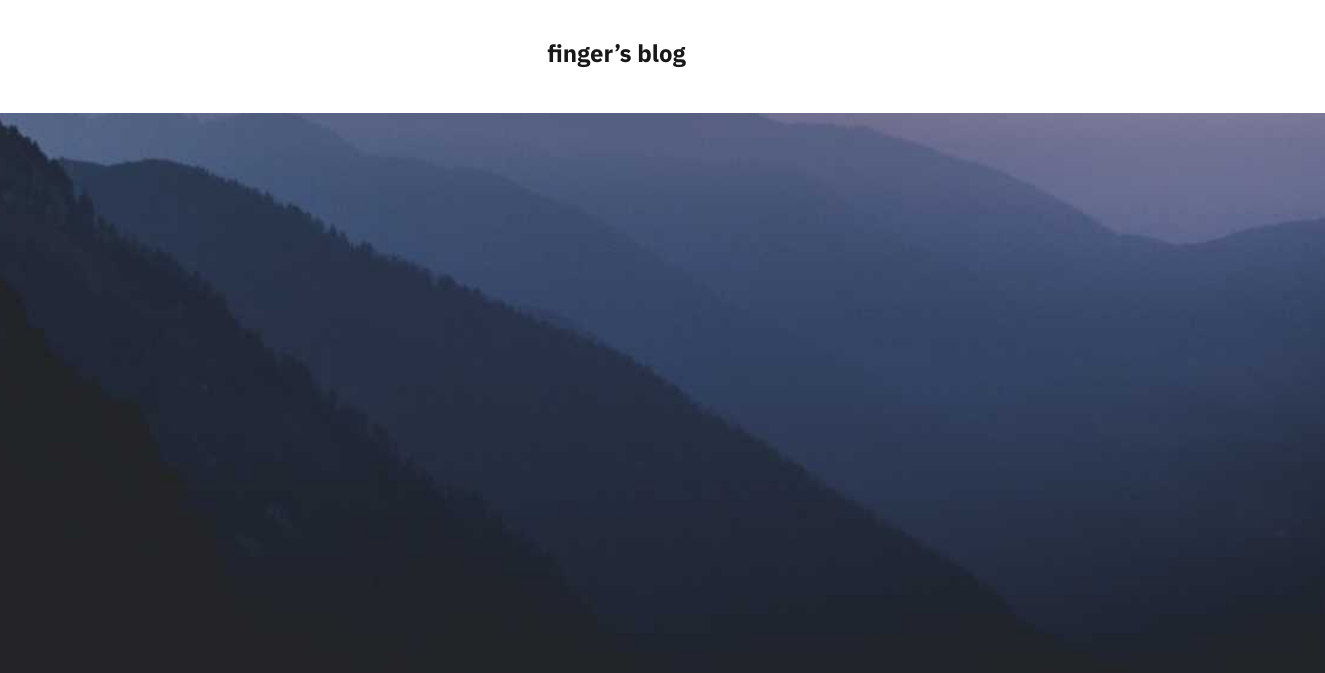- 35 Minuten Lesedauer
- Der „Kampf gegen rechts“ ist in erster Linie ein Kampf gegen die Oppositionspartei AfD. Dieser Kampf wird im Wahljahr 2024 von SPD, Grünen, der Linken, aber auch von Vertretern der CDU/CSU und der FDP mit großer Vehemenz, um nicht zu sagen Erbitterung, geführt. Große Teile der Medien und der Zivilgesellschaft wollen diesen Kampf nicht allein den anderen Parteien überlassen, sondern erklären ihn zur gesamtgesellschaftlichen Verpflichtung. Es geht um nicht weniger als „unsere Demokratie“, deren Existenz von einer Partei, die auch in den östlichen Bundesländern von einer eigenen parlamentarischen Mehrheit deutlich entfernt ist, offensichtlich akut bedroht wird. Auch die Evangelische und die Katholische Kirche wollen da nicht zurückstehen und haben sich mit voller Wucht in diese Schlacht geworfen.
„Wer die AfD wählt, unterstützt eine Partei, die das christliche Menschenbild mit Füßen tritt, programmatisch mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gegen das Gebot der Nächstenliebe verstößt und mit ihren Hetzparolen den Geist der Gemeinschaft vergiftet. Diese Partei will uns die Mitmenschlichkeit, unseren Nächsten die Menschenwürde und Gott die Ehre entreißen.“
So liest man in einer Presseerklärung der Bischöfe der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD), darunter auch der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM)1 Friedrich Kramer, vom 19.03.2024.2 Der Kampf gegen die AfD hat damit theologische Weihen bekommen. Nicht nur „unsere Demokratie“ (die es bekanntermaßen die allermeiste Zeit seit Bestehen des Christentums nicht gab) wird von der AfD bedroht, sondern es geht um Gottes Ehre. Für die Bischöfe ist die AfD offensichtlich das personifizierte Böse.
Der ganze Furor ist vor wenigen Wochen auf den Pfarrer Martin Michaelis aus Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) niedergegangen, nachdem er erklärt hatte, dass er als Parteiloser auf der Liste der AfD bei den Kommunalwahlen am 9. Juni für den Quedlinburger Stadtrat kandidieren werde. Darüber wurde bereits viel berichtet,3 weshalb an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung ausreichen soll: Nachdem er seine Kandidatur der Kirchenleitung der EKM mitgeteilt hatte, wurde ihm vom Kreiskirchenrat des Kirchenkreises Egeln ohne jede Anhörung der Dienstauftrag für den Pfarrbereich Gatersleben, in dem er tätig war, entzogen. Die Kirchenleitung forderte ihn unter Fristsetzung auf, seine Kandidatur zurückzuziehen und leitete, als er dem nicht nachkam, ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein. Zugleich wurde er vorläufig des Dienstes enthoben und es wurde ihm untersagt, im öffentlich-kirchlichen Raum Gottesdienste zu halten, das Abendmahl zu spenden, zu taufen und sonstige Amtshandlungen (Trauungen und Beerdigungen) vorzunehmen. Das alles betrachtete die Kirchenleitung offensichtlich zur Verteidigung von Gottes Ehre als geboten.
Nicht nur der Jurist fragt sich, ob das rechtens ist. Ist eine Kandidatur auf der Liste der AfD für einen Pfarrer eine Amtspflichtverletzung, die in einem Disziplinarverfahren geahndet werden kann? Diese Frage soll hier erörtert werden und für ihre Beantwortung spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob man die AfD als politische Partei unterstützt oder ob man sie ablehnt. In einem ersten Schritt werden die maßgeblichen dienstrechtlichen Vorschriften des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland (PfDG.EKD) diskutiert. Dies führt notwendig zu einem zweiten Schritt, in dem die Einstufung des AfD-Landesverbandes Thüringen durch den Verfassungsschutz als „erwiesen rechtsextrem“ näher beleuchtet wird.
Darf ein Beamter für eine Partei kandidieren, die vom Verfassungsschutz als „erwiesen rechtsextremistisch“ eingestuft wurde?
Pfarrer sind zwar (wie Richter) keine Beamten, sie haben aber insofern eine beamtenähnliche Position inne, als das Pfarrdienstverhältnis ein (kirchengesetzlich geregeltes) öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis zur Kirche als Dienstherrin ist und auf Lebenszeit begründet wird (§ 2 PfDG.EKD). Bevor die Besonderheiten des Pfarrdienstverhältnisses erörtert werden, ist es daher sinnvoll, zunächst die Frage zu beantworten, wie es sich eigentlich bei Beamten des Staates mit einer Kandidatur für die AfD verhält.
Beamte haben eine Treuepflicht gegenüber der Verfassung, für den einfachen Bürger gilt das nicht. Der Bürger kann bekennender Monarchist sein, ohne dafür belangt werden zu können, der Beamte nicht, denn Beamte müssen sich durch ihr „gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten“ [§ 33 Abs. 1 Satz 3 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG)]. Dies schließt nach allgemeiner Auffassung die Mitgliedschaft in einer vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten Partei aus, auch wenn diese, wie die NPD in der Entscheidung des BVerfG vom 17.01.2017 im zweiten NPD-Verbotsverfahren „nur“ für verfassungswidrig erklärt, aber nicht verboten wurde.
Die Mitgliedschaft in einer nicht nach Art. 21 Abs. 4 GG vom Bundesverfassungsgericht für verfassungsfeindlich erklärten Partei, die aber vom Verfassungsschutz als erwiesen extremistische, d. h. verfassungsfeindliche Bestrebung, bewertet wird, kann dagegen alleine noch nicht genügen, um den Beamten selbst als verfassungsfeindlich anzusehen.4 Es kommt vielmehr auf eine individuelle Prüfung an. Genauso wurde das auch im Falle von Robert Sesselmann, dem ersten AfD-Landrat in Deutschland, gehandhabt: Nach seinem Wahlerfolg wurde vom Regierungspräsidium als Dienstaufsichtsbehörde ein Prüfverfahren hinsichtlich seiner Verfassungstreue eingeleitet mit dem Ergebnis, dass Sesselmann Verfassungstreue und damit seine Eignung als Beamter (Landräte sind sog. Wahlbeamte) bescheinigt wurde, obwohl der AfD-Landesverband Thüringen vom Landesamt für Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wurde.5 Wäre es anders und allein die Einstufung durch den Verfassungsschutz würde genügen, um die Verfassungsfeindlichkeit der einzelnen Mitglieder zu bejahen, würde dies zu einer Art partiellem Parteiverbot durch den Verfassungsschutz führen und das, obwohl die Feststellung der Verfassungswidrigkeit und das Verbot einer Partei gem. Art. 21 Abs. 4 GG allein dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten ist. Denn die AfD könnte dann zwar noch Kandidaten für Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen aufstellen, im Erfolgsfall dürften diese aber ihr Amt nicht antreten.
Daraus, dass AfD-Mitglieder grundsätzlich Beamte werden können, folgt zugleich, dass Beamte grundsätzlich auch für die AfD kandidieren können. Andernfalls dürfte Robert Sesselmann als Landrat bei der nächsten Wahl nicht erneut kandidieren. Beamte können also grundsätzlich Mitglied in einer als erwiesen rechtsextrem bewerteten Partei sein, sie können grundsätzlich auch für diese Partei für ein Amt oder ein Mandat kandidieren und ebenso können parteilose Beamte auf der Liste dieser Partei kandidieren. Es kommt allein auf ihre persönliche Verfassungstreue an.
Die parteipolitische Betätigung von Pfarrern
Evangelische Pfarrer dürfen sich gem. § 35 PfDG.EKD um politische Mandate bewerben. Das ist nicht selbstverständlich und schon gar nicht vom Grundgesetz geboten. Katholischen Priestern ist das nach dem Katholischen Kirchenrecht untersagt (can. 285 § 3, Codex iuris canonici).6 Evangelische Pfarrer, die für die Wahl zum Europaparlament, zum Bundestag oder zu einem Landtag kandidieren, sind innerhalb der letzten zwei Monate vor der Wahl beurlaubt und wenn die Kandidatur erfolgreich war, sind sie mit der Annahme der Wahl beurlaubt (§ 35 Abs. 2 und 3 PfDG.EKD). Auf kommunaler Ebene tritt dagegen keine Beurlaubung ein, ein Pfarrer kann also gleichzeitig eine Gemeindepfarrstelle innehaben und als Stadtrat aktiv sein. Dies gilt, soweit die betreffende Landeskirche nicht von der Möglichkeit einer abweichenden Regelung (§ 35 Abs. 6 PfDG.EKD) Gebrauch gemacht hat, was die EKM nicht getan hat.7
Zu beachten sind dabei allerdings die vorangestellten Paragrafen 33 und 34 PfDG.EKD. Nach § 33 PfDG.EKD dürfen Pfarrer „einer Vereinigung nicht angehören oder sie auf andere Weise unterstützen, wenn sie dadurch in Widerspruch zu ihrem Amt treten oder in der Wahrnehmung ihres Dienstes wesentlich behindert werden.“ Vereinigungen im Sinne dieser Vorschrift sind auch Parteien. Nach § 34 PfDG.EKD müssen Pfarrer, wenn sie sich politisch betätigen, „erkennen lassen, dass das anvertraute Amt sie an alle Gemeindeglieder weist und mit der ganzen Kirche verbindet. Sie haben die Grenzen zu beachten, die sich hieraus für Art und Maß ihres politischen Handelns ergeben.“ Dies kann als das pfarrdienstrechtliche Mäßigungsgebot bezeichnet werden. Für staatliche Beamte ist das Mäßigungsgebot in § 33 Abs. 2 BeamtStG geregelt. („Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt.“)
Die Kirchenleitung der EKM hat in der Einleitungsverfügung zu dem Disziplinarverfahren gegen Pfarrer Michaelis erklärt, es bestünden zureichende Anhaltspunkte dafür, dass seine Kandidatur gegen § 34 PfDG.EKD (s. o.), § 3 Abs. 2 PfDG.EKD (Pfarrer haben „sich in ihrer Amts- und Lebensführung so zu verhalten, dass die glaubwürdige Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt wird“), § 24 Abs. 3 PfDG.EKD (Pfarrer „haben in ihrem dienstlichen und außerdienstlichen Verhalten erkennen zu lassen, dass sie dem anvertrauten Amt verpflichtet sind und dieses sie an die ganze Gemeinde weist“) und § 26 Abs. 4 PfDG.EKD (Pfarrer „haben insbesondere alles zu unterlassen, was den Zusammenhalt einer Gemeinde oder den Dienst anderer Ordinierter erschweren kann“) verstoße. Schließlich hat sie einen Anhaltspunkt für einen Verstoß gegen die Verpflichtung, Anordnungen der Dienstaufsicht zu befolgen (§ 58 Abs. 2 PfDG.EKD) darin gesehen, dass Pfarrer Michaelis der Aufforderung, seine Kandidatur zurückzuziehen, nicht nachgekommen ist.
Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass für die politische Betätigung von Pfarrern besondere Maßstäbe gelten. Grenzen der politischen Betätigung können sich dabei aus der vom Pfarrer verlangten Rücksicht auf die Gemeinde, der Rücksicht auf die Gesamtkirche und aus dem inhaltlichen Auftrag ergeben.8 Der Pfarrer muss Seelsorger der ganzen Gemeinde sein können, was nicht mehr möglich ist, wenn die politische Betätigung ihn von Teilen der Gemeinde trennt. Andererseits wird der Gemeinde aber auch ein gewisses Maß an Toleranz zugemutet, was sich allein daraus ergibt, dass Mandatsbewerbungen gem. § 35 PfDG.EKD zulässig sind. Das Spannungsverhältnis, das sich aus dem Auftrag für die ganze Gemeinde und dem politischen Engagement für einen Teil des Ganzen („Partei“ kommt vom lateinischen pars) ergeben kann, wird vom Kirchenrecht bewusst hingenommen.
Die bloße Mitgliedschaft in oder die Kandidatur für eine bestimmte Partei, ohne dass es auf das (sonstige) dienstliche oder außerdienstliche Verhalten ankäme, kann einem Pfarrer danach allein gem. § 33 PfDG.EKD verboten sein, der die Mitgliedschaft in einer Partei oder deren Unterstützung dann untersagt, wenn Pfarrer dadurch „in Widerspruch zu ihrem Amt treten oder in der Wahrnehmung ihres Dienstes wesentlich behindert werden.“ Dies käme in Betracht bei der Mitgliedschaft in einer dezidiert atheistischen Partei,9 aber auch in einer Partei, die rassistische oder in anderer Weise mit der Menschenwürde nicht zu vereinbarende politische Positionen10 vertritt und insofern als extremistisch zu bezeichnen ist. Auf letzteres bezieht sich die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, wenn sie in der Einleitungsverfügung zum Disziplinarverfahren schreibt: „Als Pfarrer wäre Pf. Michaelis verpflichtet, gegen rechtsextremistische Positionen Stellung zu beziehen. Mit der Kandidatur einer [sic!] als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Partei unterstützt er diese und leistet dem Eindruck Vorschub, als sei rechtsextremes Gedankengut vereinbar mit christlicher Theologie und Haltung. Damit unterstützt er auch die rechtsextremistische Ideologie und gefährdet nicht nur den Zusammenhalt der Kirchenmitglieder und erschwert den Dienst der ordinierten Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich für dieses Verhalten rechtfertigen müssen, sondern schadet der Kirche insgesamt.“11
Wer aber entscheidet in einem kirchlichen Disziplinarverfahren, ob die AfD extremistisch ist? Der Verfassungsschutz oder die Kirchenleitung? Die Kirchenleitung der EKM meint offenbar, dass sie die Bewertung des Verfassungsschutzes einfach übernehmen könne. Das ist allerdings nicht richtig, und zwar aus dem einfachen Grund, dass es kein Kirchengesetz gibt, nach dem für die Beurteilung der Frage, ob ein Pfarrer eine Amtspflichtverletzung begangen hat, Bewertungen des Verfassungsschutzes bindend sind. Wenn die Kirchenleitung also behauptet, dass die AfD eine rechtsextremistische Partei sei und deshalb Pfarrer Michaelis nicht für sie kandidieren dürfe, dann muss sie diesen Nachweis im Disziplinarverfahren selbst führen. Dieser Nachweis ist schwerer zu erbringen, als die Kirchenleitung mutmaßlich glaubt. Denn dass er dem Verfassungsschutz in Thüringen oder Sachsen-Anhalt gelungen ist, darf aus guten Gründen bezweifelt werden.
Die Landesverfassungsschutzämter und die Einstufung der AfD als „erwiesen rechtsextremistisch“
Auf Bundesebene hat das Oberverwaltungsgericht Münster gerade entschieden, dass die Bundes-AfD vom Verfassungsschutz als sog. Verdachtsfall geführt werden darf. In Thüringen wird der dortige Landesverband der AfD dagegen bereits seit dem 15.03.2021 als „erwiesen rechtsextremistische Bestrebung“ gem. § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ThürVerfSchG geführt, in Sachsen-Anhalt seit dem 07.11.2023 und in Sachsen seit dem 08.12.2023. Laut dem Präsidenten des Thüringer Amts für Verfassungsschutz Stephan Kramer hat sein Amt ein 700-seitiges Gutachten zur Frage der Verfassungsfeindlichkeit der AfD erstellt,12 das aber der Öffentlichkeit unter Berufung auf den Quellenschutz nicht zugänglich gemacht wird. Die Öffentlichkeit ist allein auf die Verfassungsschutzberichte 2021 und 2022 in einer Pressefassung verwiesen. Im Verfassungsschutzbericht 2021 wird dabei die AfD auf 16 Seiten behandelt, in dem für 2022 auf 7 Seiten. In Sachsen-Anhalt gibt es an offiziellen Mitteilungen bisher nur einen (ausgedruckt) 9-seitigen Text auf der Webseite des Verfassungsschutzes zur Einstufung der AfD. Auch in Sachsen liegt der Verfassungsschutzbericht für 2023 noch nicht vor, es gibt lediglich eine Pressemitteilung. Das dort erwähnte 134-seitige Gutachten wird ebenfalls nicht veröffentlicht.13
Da es die ausführlichste Darstellung ist, soll der betreffende Abschnitt im Thüringer Verfassungsschutzbericht für 2021 im Hinblick darauf, ob die Einstufung der AfD als „erwiesen rechtsextrem“ nachvollziehbar und überzeugend begründet wurde, näher beleuchtet werden. Nur insoweit sind auch die Politik der AfD bzw. Äußerungen von AfD-Politikern Gegenstand der Betrachtung. Zuvor ist aber noch zu klären, was eigentlich „rechtsextrem“ im Sinne des Verfassungsschutzes bedeutet.
Rechtsextrem und verfassungsfeindlich
Extremistisch im Sinne des Verfassungsschutzes ist gleichbedeutend mit verfassungsfeindlich und verfassungsfeindlich heißt: aktiv gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung (fdGO) gerichtet. Die freiheitliche demokratische Grundordnung bezeichnet nicht die Verfassung in ihrer Gesamtheit, sondern nur ihre Kernsubstanz. Den Begriff hat das Bundesverfassungsgericht erstmals im Jahr 1952 im Urteil zum Verbot der Sozialistischen Reichspartei (SRP)14 konkretisiert. Diese Begriffsbestimmung hat Aufnahme in das Bundesverfassungsschutzgesetz (§ 4 Abs. 2 BVerfSchG) und in die Verfassungsschutzgesetze der Länder (z. B. § 6 Abs. 2 ThürVerfSchG) gefunden. 65 Jahre später, im Urteil im zweiten NPD-Verbotsverfahren hat das Bundesverfassungsgericht eine neue, gegenüber der alten Begriffsbestimmung systematischere Präzisierung vorgenommen. Danach umfasst die freiheitliche demokratische Grundordnung drei Grundprinzipien: Menschenwürde, Demokratieprinzip und Rechtsstaatsprinzip. Die Garantie der Menschenwürde beinhaltet laut Bundesverfassungsgericht insbesondere die Wahrung personaler Individualität, Identität und Integrität sowie die elementare Rechtsgleichheit. Zum Demokratieprinzip gehört die Möglichkeit gleichberechtigter Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger am Prozess der politischen Willensbildung und die Rückbindung der Ausübung der Staatsgewalt an das Volk (Volkssouveränität). Das Rechtsstaatsprinzip schließlich umfasst die Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt, die Kontrolle dieser Bindung durch unabhängige Gerichte und das staatliche Gewaltmonopol.15
Die Sammlung und Auswertung von Informationen über „Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung (…) gerichtet sind“ ist eine der Aufgaben des Verfassungsschutzes nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 BVerfSchG) und den Verfassungsschutzgesetzen der Länder (z. B. § 4 Abs. 1 Nr. 1 ThürVerfSchG). Für ein Parteiverbot reicht eine verfassungsfeindliche Ideologie allein nicht aus. Parteien sind gem. Art 21 Abs. 2 GG erst dann verfassungswidrig und können verboten werden, wenn sie „nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden“.
Die Begründung der Einstufung des AfD-Landesverbandes Thüringen als gesichert rechtsextrem durch das Amt für Verfassungsschutz
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil im zweiten NPD-Verbotsverfahren beispielhaft gezeigt, wie die Frage der Verfassungsfeindlichkeit einer Partei zu prüfen ist. Das Gericht erörtert zunächst die Frage des Verstoßes gegen das Menschenwürdeprinzip und behandelt dabei in einem ersten Schritt die Aussagen des Parteiprogramms der NPD16 und in einem weiteren Schritt Publikationen und Äußerungen führender Funktionäre17. Das Gericht kommt dabei zu dem Ergebnis, dass sich der Verstoß gegen das Menschenwürdeprinzip bereits aus dem Parteiprogramm ergibt und dies durch die weiteren Belege untermauert wird. Bei der Frage der Verletzung des Demokratieprinzips (Verstöße gegen das Rechtsstaatsprinzip werden nicht eigens geprüft) werden ebenfalls zunächst das Parteiprogramm erörtert18 und im Anschluss daran Äußerungen und sonstige Publikationen19. Das Gericht stellt hier fest, dass die Missachtung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung hinsichtlich des Demokratieprinzips zwar dem Parteiprogramm nicht eindeutig entnommen werden kann, sich aber unter Berücksichtigung sonstiger Publikationen und Äußerungen führender Funktionäre ergibt.20 Nach der Prüfung des ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals einer Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus21 schließt dieser Teil des Urteils mit dem Fazit, dass die NPD auf die Beseitigung der Verfassungsordnung gerichtet ist22. Verboten wurde die NPD dennoch nicht, weil das Tatbestandsmerkmal des „Ausgehens“ auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung laut Bundesverfassungsgericht eine Möglichkeit des Erfolgs voraussetzt, die das Gericht angesichts des geringen politischen Gewichts der NPD verneint hat.
Man könnte erwarten, dass sich das Thüringer Amt für Verfassungsschutz bei der Prüfung der Frage der Verfassungsfeindlichkeit der Landes-AfD das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vorbild genommen und dieselben Prüfschritte abgearbeitet hätte. Was in dem 700-seitigen Gutachten steht, ist dem Autor unbekannt, weshalb es hier nicht diskutiert werden kann; die Darlegungen im Verfassungsschutzbericht 2021 lassen aber davon nichts erkennen. Es fängt schon damit an, dass das Parteiprogramm, das beim Bundesverfassungsgericht den Ausgangspunkt der Prüfung bildet, mit keinem Wort erwähnt wird. Man muss das wohl so verstehen, dass es unstreitig ist, dass das Parteiprogramm der AfD (anders als im Fall der NPD) nicht gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstößt. Dies wäre allerdings zunächst festzuhalten gewesen, weil dann die gesamte Begründungslast auf sonstigen Publikationen und auf Äußerungen von Funktionären ruht. Dass solche methodischen Überlegungen überhaupt angestellt wurden, ist nicht ersichtlich. Die 16 der AfD gewidmeten Seiten im Verfassungsschutzbericht 2021 beinhalten im Wesentlichen eine Sammlung von Facebook-Posts des Landessprechers der AfD und Fraktionsvorsitzenden im Landtag Björn Höcke, hinzu kommen einzelne Facebook-Posts des zweiten Landessprechers Stefan Möller und des AfD-Landesverbands. Schriftliche Publikationen, Reden von Abgeordneten im Landtag oder Funktionären auf Parteitagen werden nicht zitiert. Die Verfassungsfeindlichkeit der AfD soll sich danach allein aus Facebook-Posts ergeben – auch das wird methodisch nicht reflektiert. Auch die Frage – unterstellt, Höckes Posts seien verfassungsfeindlich –, unter welchen Voraussetzungen von verfassungsfeindlichen Posts des Landessprechers auf die Verfassungsfeindlichkeit des gesamten Landesverbands geschlossen werden kann, wird nicht gestellt. Hinzu kommt – und das ist das gewichtigste Argument – dass die Facebook-Posts praktisch durchgehend zu Lasten der AfD interpretiert werden, wobei die Interpretationen, die der Verfassungsschutz vornimmt, entweder nicht zwingend oder sogar unhaltbar sind. Dies soll hier zumindest an vier Beispielen gezeigt werden:
(1) Einen Verstoß gegen das Menschenwürdeprinzip sieht das Amt für Verfassungsschutz vor allem in dem, was Höcke über Migration und Migranten schreibt. Das Menschenwürdeprinzip wäre bei diesem Thema verletzt – der Verfassungsschutz formuliert diesen Obersatz allerdings nicht –, wenn aus den Posts die (rassistische) Auffassung erkennbar würde, dass für Höcke Migranten allgemein oder Migranten aus bestimmten Herkunftsländern oder -kulturen nicht die gleiche Würde wie etwa Deutsche oder andere Europäer haben, sondern Menschen von geringerer Würde seien. Dies lässt sich mit den zitierten Posts aber nicht belegen.
Das Amt führt folgenden aus der Presse bekannten Fall an: Am 28.10.2021 riss ein 25-jähriger afghanischer Flüchtling, der laut eigener Aussage den christlichen Glauben für „falsch“ hielt, in einer Kirche in Nordhausen ein mittelalterliches Kreuz von der Wand, das dabei beschädigt wurde, er zerschlug das Glas einer Vitrine und trug darin befindliche Reliefs mit Jesus-Darstellungen und weitere Gegenstände wie Stühle und Gesangbücher auf den Vorplatz der Kirche. Laut zuständigem Superintendenten des Kirchenkreises machte das alles den Eindruck einer Entwidmung der Kirche.23 Björn Höcke postete auf Facebook als Reaktion darauf am 02.11.2021 ein Foto der betreffenden Kirche. Über das Foto war (dem Layout eines Boulevardzeitungsartikels vergleichbar) in Blockschrift schräg gelegt die Aufschrift: „Afghane verwüstet die Frauenbergkirche in Nordhausen: Gekommen um zu schänden“. Der Text vor dem Doppelpunkt war dabei in kleiner Schrift, der Text nach dem Doppelpunkt in großen Lettern geschrieben. Das Amt für Verfassungsschutz bewertet das so:
„Die Darstellung steht im Widerspruch zum Menschenwürdeprinzip, da sie suggeriert, man könne aus einer Einzeltat die Botschaft ableiten, Afghanen seien als Gruppe in Deutschland, um zu ‚schänden‘. Diese Suggestion entsteht vor allem durch die Darstellung im Schriftbild, das die Kernbotschaft ‚Gekommen um zu schänden‘ von dem einschränkenden Verweis auf den Verursacher absetzt und optisch stärker betont.“24
Was ist hier passiert? – Höcke hat eine Aussage über einen konkreten Vorfall getroffen und das Verfassungsschutzamt meint, aus der Schriftgröße der Zeile „Gekommen um zu schänden“, die aus sich selbst heraus, d. h. ohne die Worte vor dem Doppelpunkt, gar nicht verständlich ist, ergebe sich, dass Höcke eine Aussage über alle afghanischen Migranten getroffen habe. Man könnte diese Interpretation des Posts virtuos nennen, wenn es nicht um so einen ernsten Vorwurf wie Verfassungsfeindlichkeit ginge. Für das Thüringer Amt für Verfassungsschutz kann sich jedenfalls ein Verstoß gegen das Menschenwürdeprinzip an der Schriftgröße entscheiden.
(2) Am 25.06.2021 erstach ein Migrant aus Somalia, der später wegen einer psychiatrischen Erkrankung als schuldunfähig beurteilt wurde, in der Würzburger Innenstadt mit einem Messer drei Frauen und verletzte fünf weitere Personen schwer. Björn Höcke postete einen Tag später: „Es interessiert mich nicht, warum der Täter nach Deutschland kam – ob er tatsächlich auf der Flucht war oder hier nur ein besseres Leben suchte. Die Art, wie er die Aufnahme dankte, zeigt: Er gehörte von Anfang an nicht hier hin.“
Das Amt für Verfassungsschutz, das in seinem Bericht unterschlägt, dass Menschen getötet wurden, sondern nur schreibt, dass der Täter Passanten mit einem Messer angegriffen habe, bewertet diesen Post so: „Die (…) Stellungnahme schließt eine Unterscheidung zwischen legitimen und illegitimen Formen von Migration und Asyl, die Teil einer demokratischen politischen Auseinandersetzung sein könnten, aus. Apodiktisch wird angenommen, die betreffende Person „gehöre von Anfang an“ nicht nach Deutschland, d. h. letztlich spiele das Verhalten des Betreffenden keine Rolle, wenn eine andere ethnische Zugehörigkeit bestehe. Zudem wird unzutreffend nahegelegt, es handele sich nicht um ein Recht auf Asyl, sondern um einen Gnadenakt.“25
Auch hier dasselbe: Höcke schreibt, dass die Tat („die Art, wie er die Aufnahme dankte“) zeige, dass der Täter von Anfang an nicht hierher gehört habe, und der Verfassungsschutz behauptet, für Höckes Urteil über den Täter spiele das Verhalten des Betreffenden keine Rolle, sondern allein seine ethnische Zugehörigkeit. Kann man den Sinn einer Aussage noch stärker verdrehen?26
(3) Das Amt für Verfassungsschutz unterscheidet auch nicht zwischen Kritik an den realen Zuständen staatlicher Institutionen und der Ablehnung der den Institutionen zugrunde liegenden Verfassungsprinzipien. So schreibt der Verfassungsschutz unter der Überschrift „Angriffe auf das Rechtsstaatsprinzip“ über einen Facebook-Post des zweiten Landessprechers der Thüringer AfD: „Stefan Möller führte in einem Facebook-Post vom 23. Mai zum Bundesverfassungsgericht als höchstem Organ der Rechtsprechung in der Bundesrepublik aus, das Grundgesetz sehe ‚effektiven Rechtsschutz … auch gegen Übergriffe des Staates – also der regierenden Parteien‘ vor. Dieser bestehe allerdings in der Bundesrepublik nicht, denn der ‚normale Bürger‘ finde dort ‚kaum Gehör‘ und auch die ‚größte Oppositionsfraktion‘ – gemeint ist die AfD – habe dieses Recht nicht. Die Richter würden ‚von der herrschenden politischen Mehrheit sorgfältig ausgewählt und eingesetzt‘ und entschieden zugunsten der politischen Parteien. Als Beispiel führte Möller die Berufung eines Verfassungsrichters an, dem er unterstellt, auch in seiner Funktion als Richter weiterhin an Positionen festzuhalten, die er als ‚Bundestagsabgeordneter der CDU‘ vertreten habe.“ Das Amt bewertet das so: „Die AfD Thüringen stellt Institutionen des Rechtsstaats als politisch einseitig gelenkt, als unveränderlich und damit als illegitim dar. …Der AfD-Landessprecher spricht (…) den unabhängigen Gerichten ihre Kontrollfunktion und somit der Bundesrepublik ein System demokratischer Gewaltenteilung ab.“27
Auch hier erübrigt sich im Grunde ein Kommentar: Wer die realen Zustände in der Justiz (ob zu Recht oder Unrecht spielt hier keine Rolle) unter Berufung auf das Grundgesetz (!) kritisiert, also eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit beklagt, wendet sich laut Verfassungsschutz gegen den Anspruch, hier das Rechtsstaatsprinzip.
(4) Schließlich wird auch die Kritik an der Corona-Politik als Beleg für den Extremismus der AfD gewertet. Höcke schreibt in einem Facebook-Post: „Unsere Grund- und Freiheitsrechte werden ohne Tatsachengrundlage, also willkürlich, außer Kraft gesetzt. Die Stimmungsmache der regierungsnahen Medien mit ihren immer neuen Corona-Bedrohungsszenarien kann keinen aufgeklärten Demokraten in seinem Urteil mehr täuschen: Deutschland ist kein Rechtsstaat mehr! (…) Das ist das letzte verzweifelte Aufbäumen einer mißbrauchten Staatsmacht und gleichzeitig deren Bankrotterklärung. Sie zeigen damit, dass sie keine Macht mehr haben. Die Menschen in Thüringen und Sachsen kennen diese Situation.“
Die Bewertung des Verfassungsschutzes: „(…) Es handelt sich um eine Rhetorik, die u. a. mit Rekurs auf die ehemalige DDR Vertrauen systematisch und mit dem Ziel erodiert, ein Klima der Angst vor vermeintlicher staatlicher Willkür zu erzeugen. Dies kann auch insgesamt als das Ziel der AfD Thüringen angesehen werden, die damit ihre dezidiert verfassungsfeindlichen Ziele offenbarte.28
Man kann den Vergleich mit der Situation am Ende der DDR („Die Menschen in Thüringen und Sachsen kennen diese Situation“) in Höckes Post verfehlt finden, aber an welcher Stelle wendet sich Höcke gegen das Prinzip gleichberechtigter Teilnahme aller Bürger am Prozess der politischen Willensbildung, wo gegen die Volkssouveränität, die Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt, die Unabhängigkeit der Gerichte oder das staatliche Gewaltmonopol? Das müsste der Verfassungsschutz aufzeigen, wenn er Höcke (und mit ihm dem Landesverband, auf den die Wertung ohne Begründung erstreckt wird) eine Missachtung des Demokratieprinzips und des Rechtsstaatsprinzips zur Last legt. Nichts davon leistet er, es wird gar nicht der Versuch einer Subsumtion unternommen. Für den Verfassungsschutz gilt offenbar: Wer die Regierung in einer Weise kritisiert, die der Verfassungsschutz für unangemessen erachtet, weil sie dem „Vertrauen in die Regierung“ abträglich ist, ist ein Verfassungsfeind. Als wäre die Regierung mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung identisch.29
Man muss es so hart sagen: Was der Verfassungsschutz Thüringen als Begründung seiner Einstufung der AfD Thüringen als „erwiesen rechtsextremistisch“ präsentiert, ist ein intellektueller und ein verfassungsrechtlicher Offenbarungseid. Wer sich eines 700-seitigen Gutachtens zur AfD berühmt, müsste doch zumindest ein „Best-of“ an Äußerungen von Parteifunktionären liefern können, die jedenfalls für sich betrachtet zweifelsfrei verfassungsfeindlich sind. (Wobei die Frage, ob der Schluss auf die Verfassungswidrigkeit des gesamten Landesverbandes gerechtfertigt ist, auch dann noch gesondert zu beantworten wäre.30)Das Thüringer Amt für Verfassungsschutz kann das aber nicht. Der Verfassungsschutz greift mit seiner Bewertung der AfD als „erwiesen rechtsextrem“ gravierend in den demokratischen Wettbewerb der Parteien und damit in die demokratischen Willensbildungsprozesse selbst ein31 und kann keine Begründung liefern, die auch nur ansatzweise überzeugen könnte. Würde die Antifa einen solchen Text als „Dossier“ über die AfD liefern, müsste man nicht überrascht sein. Niemand würde sich wundern, dass er durch und durch tendenziös ist und die Autoren in methodischer und verfassungsrechtlicher Hinsicht ihrem Gegenstand offenkundig nicht gewachsen sind. Aber wenn ein staatliches Amt mit über 100 Mitarbeitern, darunter vielen Juristen, einen solchen Text verantwortet, dann ist das nicht nur ein rechtsstaatliches Problem.
Der Verfassungsschutzbericht für 2022 bringt gegenüber dem für 2021 keine Verbesserung. Auch hier werden Äußerungen von AfD-Politikern zusammengetragen, die vom Verfassungsschutz als illegitim erachtet und als Belege für die Verfassungsfeindlichkeit der AfD gewertet werden, ohne näher zu prüfen, ob die Äußerungen tatsächlich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind. Wenn etwa Björn Höcke in Reden behauptet, in Deutschland finde eine zielgerichtete „Ersetzungsmigration“ statt, dann kann man das zwar als politischen Unsinn bewerten, dieses Narrativ ist aber per se weder gegen das Menschenwürdeprinzip, noch gegen das Demokratie- oder gegen das Rechtsstaatsprinzip gerichtet.32
Für Sachsen-Anhalt gibt es, wie erwähnt, bisher nur eine Kurzbegründung des Verfassungsschutzes zur Einstufung des dortigen Landesverbandes der AfD, die genauso unzulänglich argumentiert wie die Berichte aus Thüringen. Ein Beispiel muss hier genügen: Der Landtagsabgeordnete Daniel Wald kommentierte am 13.01.2021 auf Facebook einen Beitrag von Focus Online mit dem Titel „+++ Eilmeldung +++ Erstes Bundesland erlässt Sonderregeln für Geimpfte …“ mit den Worten: „Die totale Diktatur entfaltet ihre perversen Züge!“. Dies zitiert der Verfassungsschutz als Beleg für die Behauptung, dass die AfD Sachsen-Anhalt die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie in ihrer derzeitigen Form anstrebe. Auch hier wird Kritik am konkreten Zustand der Demokratie mit Kritik am Demokratieprinzip gleichgesetzt.
In vielen Medien und einer breiten Öffentlichkeit wird allerdings die Einstufung als „erwiesen rechtsextrem“ in Thüringen und Sachsen-Anhalt behandelt, als müsste man sie nicht hinterfragen. Dass der Verfassungsschutz in seiner Existenz nicht unumstritten ist,33 die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen noch 2012 die Abschaffung der Verfassungsschutzämter forderte,34 die Linke diese Forderung erhebt35 und aktuell Autoren wie Mathias Brodkorb36 und Ronen Steinke37 für seine Abschaffung plädieren, wird dabei ignoriert. Ausgerechnet die Kirchen, denen Distanz zu den Geheimdiensten ganz sicher nicht schlecht anstehen würde, lesen dem Verfassungsschutz alles von den Lippen ab. Die Synode (das Parlament der Landeskirche) der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat bei ihrer Frühjahrstagung 2024 am 13. April ein „Wort der Landessynode zum Wahljahr 2024“38 verabschiedet, in dem es heißt: „Die AfD arbeitet gezielt gegen die Grundlagen unserer parlamentarischen Demokratie und verfolgt eine langfristig angelegte Strategie ihrer Abschaffung zugunsten eines homogen völkischen, autoritär regierten Staatswesens, das sich nach Gutdünken auch über geltendes Recht hinwegsetzt.“
Hier spricht dieselbe Selbstgewissheit des eigenen Urteils, mit der auch der Verfassungsschutz zu seinen vollkommen unzulänglich begründeten Bewertungen kommt. Nicht nur, aber besonders für eine Kirche ist das unverantwortlich. Im Disziplinarverfahren gegen Pfarrer Michaelis können solche Behauptungen nicht ausreichen. Um in diesem Verfahren den Nachweis zu führen, dass die AfD eine extremistische Partei ist, muss die Kirche zeigen, dass sie der bessere Geheimdienst ist.
Endnoten
1Das Gebiet der EKM umfasst im Wesentlichen (nicht ganz) die Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt, außerdem kleine Teile von Brandenburg und Sachsen.
2Presseerklärung vom 19.03.2024. Dazu und zu weiteren öffentlichen Äußerungen der Evangelischen und der Katholischen Kirchen zur AfD vom Autor: Ausgrenzung ist Nächstenliebe.
3Eine kleine Auswahl: Sachsen-Anhalt: AfD-naher Pfarrer weist Vorwürfe der Evangelischen Kirche zurück | WELT vom 10.04.2024, Pfarrer Martin Michaelis: Disziplinarverfahren gegen AfD-nahen Pfarrer eingeleitet | ZEIT ONLINE vom 09.04.2024, Pfarrer in der Politik: Kirche versus AfD | ZEIT ONLINE vom 03.04.2024.
4Josef Franz Lindner: Zur Parteimitgliedschaft von Beamten, VerfBlog, 2019/2/15.
5 Darf im Amt bleiben: Sonneberger AfD-Landrat Sesselmann besteht Verfassungstreue-Prüfung | MDR vom 10.07.2023.
6Es gibt dennoch Ausnahmen: In Bayern sitzen Ordensleute in Gemeinderäten: Kirche-und-Leben.de – Warum katholische Priester keine Politiker werden dürfen.
7Anders z. B. die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, bei der Gemeindepfarrer nicht gleichzeitig Inhaber eines kommunalen Mandats sein können.
8Christian von Lenthe, Zur politischen Betätigung von kirchlichen Mitarbeitern in den evangelischen Landeskirchen der EKD und ihrer Zusammenschlüsse, Frankfurt: Peter Lang 1991, S. 146 ff.
9In den 1970er Jahren gab es in der EKD eine Anzahl Fälle von Pfarrern, die Mitglied in der DKP waren. Wie damit umgegangen werden sollte, war strittig, es kam auch zu Suspendierungen. Der Rat der EKD empfahl schließlich eine Einzelfallprüfung, die bloße Mitgliedschaft sollte nicht zum Ausschluss vom Amt führen und Disziplinarverfahren (damals noch Amtszuchtverfahren genannt) die Ausnahme bleiben (Knigge für Rote | DER SPIEGEL).
10Die NPD hatte in ihrem Parteiprogramm die gesetzliche Möglichkeit der Kastration von Pädophilen gefordert (vgl. BVerfG, 17.01.2017, 2 BvB 1/13, juris, Rn. 644).
11Nach dem Willen der Kirchenleitung und der Synode sollen AfD-Mitglieder auch nicht mehr bei den 2025 anstehenden Gemeindekirchenratswahlen kandidieren dürfen (EKMD | Tagungen | 7. Tagung der III. Landessynode vom 11. bis 13. April 2024 im Kloster Drübeck, dort unter Beschlüsse: DS 10.2/2B). Dazu auch: Ausgestoßen! Interview mit einem Thüringer Gemeindekirchenratsmitglied, das nicht mehr paßt (tichyseinblick.de).
12So Kramer mündlich am 19.04.2024 bei einer Tagung der Evangelischen Akademien Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Berlin in Halle (Saale).
13Sachsen: Verfassungsschutz will AfD-Gutachten geheimhalten | DIE ACHSE DES GUTEN. ACHGUT.COM vom 03.01.2024.
14BVerfGE 2, 1.
15BVerfG, 17.01.2017, 2 BvB 1/13, juris, Leitsatz 3 und Rn. 535-547.
16BVerfG, a. a. O., Rn. 637-652.
17BVerfG, a. a. O., Rn. 653-757.
18BVerfG, a. a. O., Rn. 759-760.
19BVerfG, a. a. O., Rn. 761-802.
20BVerfG, a. a. O., Rn. 758.
21BVerfG, a. a. O., Rn. 805-843.
22BVerfG, a. a. O., Rn. 844.
23Afghane beschädigt Kirche: Thüringen debattiert über Asylpolitik | NZZ vom 01.11.2021.
24Verfassungsschutzbericht 2021 Freistaat Thüringen, Pressefassung, S. 22.
25Verfassungsschutzbericht 2021 Freistaat Thüringen, Pressefassung, S. 19.
26Auf die Frage des ethnisch-kulturellen Volksbegriffs und seine Bedeutung für den Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit an die AfD kann hier nicht näher eingegangen werden. Dazu ausführlich Brodkorb, Gesinnungspolizei im Rechtsstaat? Der Verfassungsschutz als Erfüllungsgehilfe der Politik, Springe: zu Klampen Verlag 2024, S. 140 ff, sowie zum Urteil des OVG Münster vom 13.05.2024 Dietrich Murswiek in einem Interview des Kontrafunk vom 15.05.2024.
27Verfassungsschutzbericht 2021 Freistaat Thüringen, Pressefassung, S. 26.
28Verfassungsschutzbericht 2021 Freistaat Thüringen, Pressefassung, S. 32.
29Für nach dem Urteil des Verfassungsschutzes überzogene Kritik an der Regierung und anderen demokratischen Institutionen hat das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem Bericht für 2021 den neuen Beobachtungsbereich der „verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates“ erfunden (dazu Murswiek, Wer delegitimiert hier wen?, LTO vom 14.11.2022).
30Das Verwaltungsgericht Gera ist in einer Entscheidung vom 10.08.2023 (Az. 1 E 564/23 Ge, juris) in der es um den Widerruf einer waffenrechtlichen Erlaubnis eines AfD-Mitgliedes ging, zu dem Ergebnis gekommen, dass – unterstellt, die Posts von Höcke seien verfassungswidrig – weder aus dem Verfassungsschutzbericht 2021 noch aus einem nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Vermerk, der vom Amt für Verfassungsschutz dem Gericht zur Verfügung gestellt wurde, die Verfassungsfeindlichkeit des gesamten Landesverbands der AfD folge (a. a. O., juris,Rn. 25).
31Vgl. Volker Boehme-Nessler, Der Geheimdienst und die AfD, Cicero vom 14.03.2024.
32Mit Brodkorb, a. a. O., S. 17 f. könnte man dieses Narrativ auch als „unberechtigte Verschwörungstheorie“ bezeichnen. Brodkorb definiert eine Verschwörung als „zielgerichtete(s) Handeln eines Personenzusammenschlusses auf der Grundlage eines geheimen Planes“ und Verschwörungstheorien als „Versuch, (wichtige) Ereignisse als Folge derartiger geheimer Absprachen und Aktionen zu erklären.“ Da es unbestreitbar Verschwörungen gab und gibt, ist Verschwörungstheorie damit ein grundsätzlich neutraler Begriff und es kommt allein darauf an, ob sie berechtigt oder unberechtigt sind. Unberechtigte Verschwörungstheorien unterscheiden sich von den berechtigten „entweder durch die erwiesene Falschheit ihrer Unterstellungen oder die anhaltende Nichtnachweisbarkeit ihrer Richtigkeit“. Der Verfassungsschutz verwendet dagegen den Begriff Verschwörungstheorie durchgehend pejorativ, obwohl seine eigene Aufgabe nach Brodkorb darin besteht, „berechtigte Verschwörungstheorien über tatsächliche Staatsfeinde zu verfertigen.“
33Es gibt in keiner anderen westlichen Demokratie eine Behörde zur Prüfung der politischen Gesinnung der Bürger wie den Verfassungsschutz. Dazu näher Brodkorb, a. a. O., S. 13.
34Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsbeschluss vom 27.11.2012.
35Linke will Geheimdienste abschaffen | heise online. Vgl. auch: Außer Kontrolle – Wie der Verfassungsschutz die Verfassung bedroht | Fraktion DIE LINKE im nordrhein-westfälischen Landtag.
36Brodkorb, a. a. O., S. 194 ff.
37Ronen Steinke: Verfassungsschutz – Weg mit dem Geheimdienst! (fr.de).
38EKMD | Tagungen | 7. Tagung der III. Landessynode vom 11. bis 13. April 2024 im Kloster Drübeck, dort unter Beschlüsse: DS 10.3-2.
2 Kommentare
Maik Bialek auf 13. Juni 2024 bei 8:00
#
Danke für diesen Kommentar. Ich habe vor gut fünf Wochen dem Kreiskirchenamt aufgrund des Beschlusses der Landessynode der EKM vom 13. April 2024 zur AfD mitgeteilt, keinen (freiwilligen) Gemeindebeitrag mehr zu zahlen. Das Wort der Landessynode zum Wahljahr 2024 wurde im kirchlichen Mitteilungsblatt ohne weiteren Kommentar abgedruckt.
Eine Antwort auf mein Schreiben gab es freilich nicht, der Kirchenaustritt wird dann wohl der nächste Schritt sein.
Quelle